
Arzneimittelsicherheit braucht Vielfalt
Zulassung und Marktüberwachung

Gendermedizin wird oft missverstanden. Viele denken dabei an Frauenmedizin oder vielleicht an LGBTIQ-Themen. Tatsächlich geht es aber darum, biologische und soziale Unterschiede – also Sex und Gender – in Diagnostik, Therapie und Forschung zu berücksichtigen. Sie beeinflussen, wie Krankheiten entstehen, welche Symptome auftreten und wie gut Therapien wirken.
Ein typisches Beispiel ist der Herzinfarkt: Klassischerweise wird dieser mit einem stechenden Brustschmerz beschrieben, der in den linken Arm ausstrahlt. Bei Frauen treten jedoch oft Symptome wie Rückenschmerzen, Übelkeit oder Atemnot auf. Da diese nicht als «typisch» gelten, wird ein Herzinfarkt bei Frauen häufiger übersehen oder als Panikattacke fehlgedeutet – mit oft fatalen Folgen.
Ein Beispiel für die Benachteiligung von Männern ist die Osteoporose, die als «Frauenkrankheit» gilt. Doch auch Männer erkranken daran – oft unbemerkt.
Die physiologischen und biologischen Voraussetzungen von Männern und Frauen beeinflussen stark, wie Krankheiten entstehen und wie Therapien wirken. Frauen haben zum Beispiel ein aktiveres Immunsystem; das macht sie anfälliger für Autoimmunerkrankungen, aber oft widerstandsfähiger gegen Krebs. Bezogen auf Therapien: Problematisch ist, dass in der Medizin meist der männliche Körper als Norm und der weibliche Körper als Abweichung gilt. Frauen und Männer verstoffwechseln Medikamente unterschiedlich, viele Substanzen bleiben bei Frauen länger im Körper und führen daher auch zu mehr Nebenwirkungen als bei Männern.
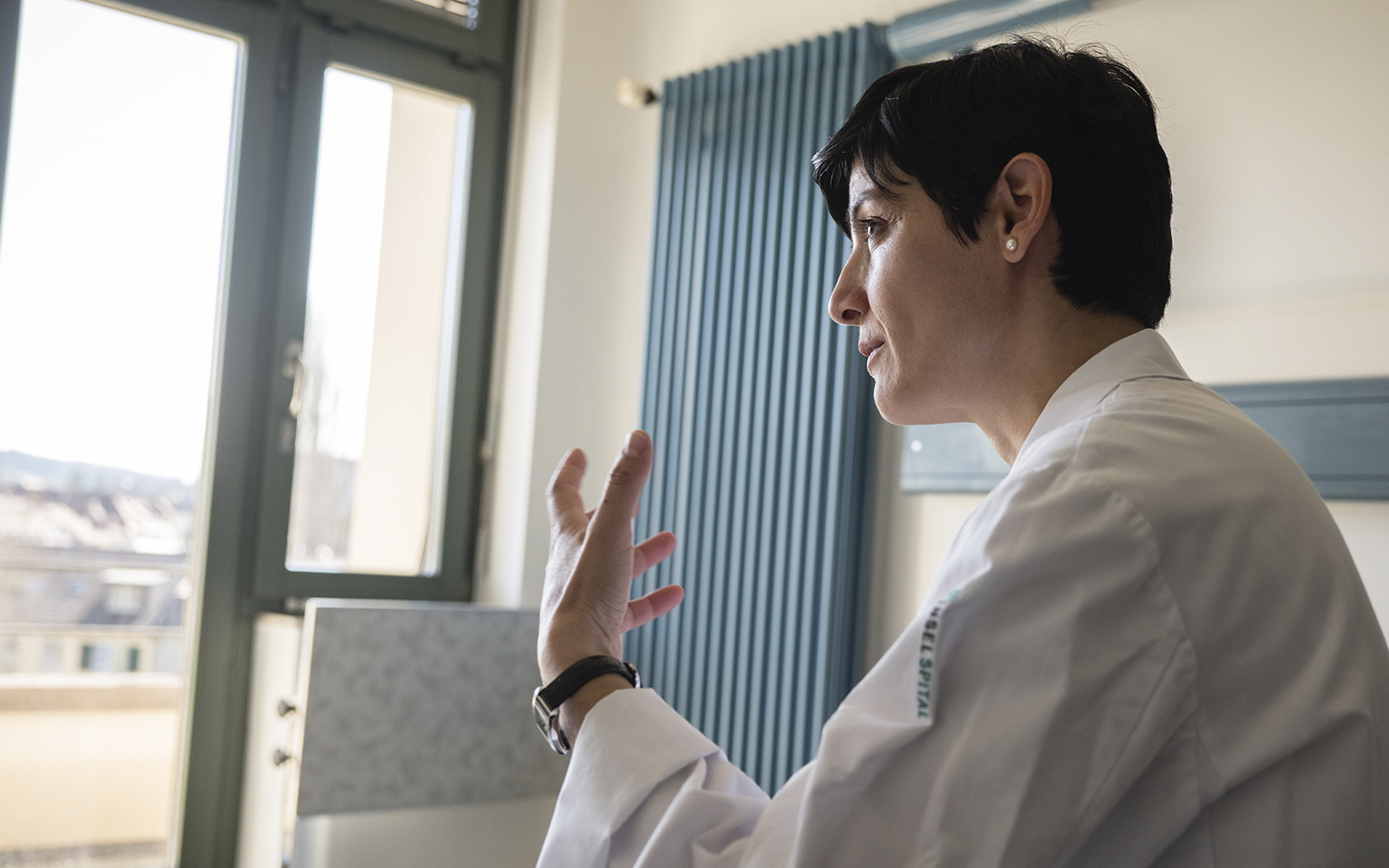
Sie beeinflussen, wie Patientinnen und Patienten Beschwerden kommunizieren, wie die Fachpersonen diese interpretieren und welche Therapieansätze letztlich gewählt werden. Bei Frauen werden Beschwerden wie Magenprobleme oder Erschöpfung oft zuerst auf psychologische Ursachen zurückgeführt – während sie bei Männern eher abgeklärt werden. Frauen neigen auch dazu, eigene gesundheitliche Probleme zurückzustellen, weil sie sich um Familie und Angehörige kümmern.
Männer erkranken insgesamt häufiger an Krebs. Doch bestimmte Krebsarten wie Schilddrüsen- oder Gallenblasenkrebs treten bei Frauen häufiger auf. Frauen haben meist ein stärkeres Immunsystem, das sie bis zu einem gewissen Grad vor Krebs schützen kann. Zudem haben Östrogene – insbesondere vor der Menopause – eine schützende Wirkung gegen Krebsentstehung.
Neben diesen biologischen Faktoren spielen auch soziale Aspekte eine Rolle: Im Durchschnitt rauchen Männer mehr und trinken mehr Alkohol. Frauen haben ein anderes Gesundheitsverhalten, und inwiefern der (berufliche) Kontakt mit Reinigungsmitteln oder mit Kosmetika das Krebsrisiko beeinflusst, ist noch unklar.
Geschlechtsspezifische Unterschiede wirken sich stark auf die Diagnose aus. So wird zum Beispiel Blasenkrebs bei Frauen oft erst spät erkannt, da Symptome wie Blut im Urin zunächst als Harnwegsinfekt fehlinterpretiert und mit Antibiotika behandelt werden.
Frauen sind sensibler für Hautkrebsrisiken und lassen sich früher untersuchen. Bei ihnen treten Melanome eher an den Beinen auf, bei Männern eher an Brust und Bauch, sie gehen später zur Untersuchung, was die Prognose verschlechtert.
«Gendermedizin ist kein vorübergehendes Trendthema, sondern kann über Leben und Tod entscheiden.»
Frauen leiden aufgrund ihres langsameren Stoffwechsels und der geringeren Muskelmasse häufig stärker unter den Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Dennoch werden die Medikamente oft in Standarddosierungen verabreicht, die sich an der Körperoberfläche orientieren. Das kann fatale Folgen haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Blasenkrebspatientin, welche die Chemotherapie vor der Tumoroperation wegen starker Nebenwirkungen abbrechen musste, was wiederum die Heilungschancen negativ beeinflusste. Die Patientin starb. Möglicherweise hätte ihr Leben gerettet werden können, wenn es besser angepasste Behandlungsmöglichkeiten gegeben hätte.
Ein Fall von vielen, der zeigt: Gendermedizin ist kein vorübergehendes Trendthema, sondern kann über Leben und Tod entscheiden. Die Medizin muss geschlechtersensibler werden, damit alle die bestmögliche Behandlung erhalten – auch Männer. Beispiel Brustkrebs: Nur ein Prozent der Brustkrebsfälle betrifft Männer. Er wird aber oft genauso behandelt wie bei Frauen, ohne dass es genügend Studiendaten gibt, die dies rechtfertigen.
Weil klinische Studien lange Zeit fast nur mit Männern durchgeführt
wurden. Nach dem Contergan-Skandal wollte man Frauen schützen – so
wurden sie jahrzehntelang von Studien ausgeschlossen. Auch heute
noch sind sie unterrepräsentiert.
Aktuell hat die Industrie wenig Anreiz, geschlechtsspezifische Forschung
zu betreiben – sie ist teuer und aufwendig. Statt kostspielige neue Studien
zu finanzieren, könnten aber vorhandene klinische Daten auf geschlechtsspezifische
Unterschiede hin analysiert werden. Oft wäre eine Anpassung der Dosierung
schon ein grosser Fortschritt, um Nebenwirkungen zu reduzieren.
Auch Alter, ethnische Herkunft und soziale Lage sollten stärker berücksichtigt werden: Oft werden zum Beispiel ältere Menschen ausgeschlossen, obwohl sie häufig Medikamente brauchen und sich der Stoffwechsel im Alter verändert, was Wirkung und Nebenwirkungen beeinflusst. Auch ethnische Unterschiede spielen eine Rolle: So reagieren etwa asiatische Patientinnen und Patienten oft anders auf gewisse Medikamente als europäische. Zudem sind auch sozioökonomisch benachteiligte Gruppen seltener in Studien vertreten. Eine vielfältigere medizinische Forschung mit einer intersektionalen Perspektive würde dazu beitragen, eine gerechtere Medizin zu entwickeln.
«Ein Verzicht auf Diversitätsziele in der klinischen Forschung könnte die Arzneimittelentwicklung stark zurückwerfen.»
Es gibt Fortschritte: Leitlinien wie die Sex and Gender Equity in Research (SAGER) Guidelines fordern, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in der medizinischen Forschung systematisch berücksichtigt werden. Wissenschaftliche Fachjournale verlangen zunehmend, dass Studien geschlechtsspezifische Daten ausweisen. Das Bewusstsein für Gendermedizin wächst, vor allem bei der jüngeren Generation, doch strukturelle Hürden verhindern oft den Aufstieg von Frauen in Führungspositionen. Dabei sind sie es, die massgeblich zu Geschlechterunterschieden forschen. Ohne eine grössere Präsenz von Frauen in Schlüsselpositionen sind daher echte Fortschritte in der Umsetzung von geschlechtersensibler Medizin nur schwer zu erreichen.
Auch bei Tierversuchen und in der präklinischen Forschung findet ein Umdenken statt: Wurden hier lange Zeit fast nur männliche Versuchstiere in präklinischen Studien eingesetzt, gibt es inzwischen Vorgaben, weibliche Tiere einzubeziehen.
In der Wissenschaft wird das Thema Gendermedizin intensiv diskutiert. Es gibt aber politische Widerstände, vor allem in den USA, wo seit Beginn der Trump-Ära Forschungsprojekte, die sich mit vulnerablen Bevölkerungsgruppen oder geschlechtsspezifischen Fragen befassen, benachteiligt werden. Allein die Verwendung bestimmter Begriffe kann dazu führen, dass Fördergelder gestrichen oder Forschungsanträge nicht bewilligt werden.
Wenn wir die Präzisionsmedizin wirklich voranbringen wollen, dürfen wir uns nicht von ideologischen Widerständen entmutigen lassen, sondern müssen konsequent für eine inklusive und evidenzbasierte Medizin eintreten. Ein Verzicht auf Diversitätsziele in der klinischen Forschung könnte die Arzneimittelentwicklung stark zurückwerfen. Das Wissen über geschlechtsspezifische Unterschiede ist da – die Umsetzung in die Praxis bleibt aber eine Herausforderung. Wir müssen mehr Daten generieren, die konkrete Veränderungen ermöglichen. Entscheidend wäre, Frauen und Männer als zwei eigenständige Populationen zu analysieren.
Ein wichtiges Innovationsfeld ist die Medikamentendosierung. Faktoren wie Geschlecht, Körpergrösse und Gewicht sollten schon in frühen Studienphasen berücksichtigt werden – das erhöht nicht nur Sicherheit und Wirksamkeit, sondern schafft auch die Basis für individuellere Therapien.
Ich sehe Swissmedic in einer wichtigen Rolle: Einerseits muss die Sicherheit der Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt stehen, andererseits braucht es Offenheit für Innovation – auch wenn die Datenlage nicht immer perfekt ist.
Gerade in der Gendermedizin kann Swissmedic gezielt Impulse setzen, wie sie es aktuell auch tut, indem sie bei der Zulassung die Studiendaten gesondert nach Geschlecht anschaut und, wo Daten fehlen, zusätzliche Analysen verlangt. So lassen sich Unterschiede in Wirkung und Nebenwirkungen besser verstehen und berücksichtigen. Wenn wir geschlechterspezifische Unterschiede auf allen Ebenen von der Medikamentenentwicklung bis zur Zulassung stärker berücksichtigen, ist das eine grosse Chance für eine bessere medizinische Versorgung für alle.